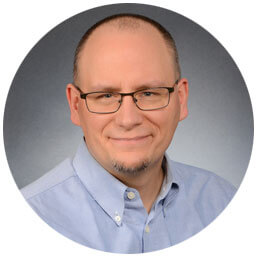Wärme steigt nach oben. Und genau das wird für einige Eigenheimbesitzer zum Problem. Denn über ein ungedämmtes Dach kann bis zu 30 % der Gesamtwärme eines Hauses verloren gehen – und damit auch das Geld, das für die Energie bezahlt wurde. Eine Dachsanierung mit Dämmstoff und einer hohen Dämmwirkung von unterschiedlichen Dämmmaterialien kann sehr effizient sein und die Heizkosten nachhaltig reduzieren.
Dachdämmung auf einen Blick
- Eine gute Dachdämmung senkt den Wärmeverlust, verbessert das Raumklima und kann die Heizkosten deutlich reduzieren.
- Je nach Dachkonstruktion kommen verschiedene Dämmmethoden infrage: Zwischen-, Unter- oder Aufsparrendämmung.
- Die Kosten hängen vom Material, der Bauweise und dem Aufwand ab, können aber durch Förderprogramme von BAFA und KfW abgefedert werden.
- Wer sein Dach nicht nutzt, muss dennoch die oberste Geschossdecke dämmen – das schreibt das Gebäudeenergiegesetz vor.
Wozu eine Dachdämmung?
Eine gute Dachdämmung schützt im Winter vor Kälte und vor zu hohen Rechnungen, hilft aber auch im Sommer bei der effektiven Klimatisierung. Schließlich gilt: Wo die Wärme nicht entweicht, wird auch die kühle Luft länger gehalten. Wer von der Sanierungspflicht betroffen ist und/oder 365 Tage im Jahr ein angenehmes Raumklima genießen möchte sowie die Energierechnung auf einem Minimum halten will, plant am besten schnellstmöglich eine passende Dachdämmung.
Ein Dachdecker erkennt die Potenziale schnell und kann Sie nicht nur zu verschieden Dacharten, sondern auch zum Thema Dachboden Ausbauen beraten. Auch für die Art der Dämmung und die Kosten für die Dachdämmung kann der Dachdecker erste Prognosen abgeben.
Muss ich mein Dach dämmen, auch wenn der Dachboden ungenutzt bleibt?
Nicht immer ist es notwendig, das Dach komplett zu dämmen – zumindest dann nicht, wenn der Dachboden unbeheizt und ungenutzt ist. In diesem Fall reicht es aus, die oberste Geschossdecke zu dämmen. Das allerdings ist gesetzlich vorgeschrieben: Gemäß § 47 GEG sind Hausbesitzer dazu verpflichtet, die oberste zugängliche Geschossdecke zu dämmen, wenn diese nicht den Mindestanforderungen an den Wärmeschutz entspricht und sich darüber ein unbeheizter Raum befindet.
Die gute Nachricht: Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist deutlich einfacher und kostengünstiger umzusetzen. Sie lässt sich entweder als Dämmung unterhalb der Decke (z. B. in Holzbalkendecken) oder als Aufdopplung auf der Decke realisieren – je nachdem, ob der Dachboden begehbar bleiben soll.
Wichtig: Die Pflicht zur Dämmung gilt nur für selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser, die nach dem 1. Februar 2002 erworben wurden. Wer das Haus vorher schon bewohnt hat, ist von dieser Pflicht ausgenommen – zumindest so lange, bis eine umfassende Sanierung ansteht oder das Gebäude verkauft wird.
Dämmung: Der richtige Ansatz für jedes Dach
Bevor wir über die Kosten einer Dachdämmung sprechen können, müssen wir erst einmal klären, welche Art der Dachdämmung überhaupt infrage kommt. Grundsätzlich unterscheiden sich drei Arten der Sparrendämmung. Für Ungeübte: Sparren werden die tragenden Teile des Dachs genannt – also alle Balken, die vom First bis runter zur Traufe verlaufen. Dabei gibt es von der Größe der Dachfläche über die Art der Dachsparren als auch bei den Dämmmaterialien größere Unterschiede – auch bei den Gesamtkosten.
- Am häufigsten wird das Dämmmaterial genau passend zwischen diese Sparren geklemmt und dort befestigt. Obwohl die Dämmstärke dann natürlich durch die Sparrenhöhe begrenzt ist und dem Dämmwert ein Limit setzt, ist eine solche Zwischensparrendämmung auf Platz eins der häufigsten Dachdämmmethoden. Hauptsächlich, weil keine baulichen Änderungen vorgenommen werden müssen und die Dämmung auch problemlos nachträglich eingebaut werden kann.
- Wem das noch nicht genug ist oder wessen Dach für diese Methode nicht geeignet ist, für den ist eine (ggf. zusätzliche) Untersparrendämmung meist die richtige Wahl. Hierbei wird das Dämmmaterial in Richtung des Innenraums, , also unterhalb der Sparren, angebracht. Diese Form der Dämmung wird allerdings selten alleinig verwendet. Denn wer damit einen angemessenen Dämmwert erreichen möchte, muss mit erheblichen Einbußen der Raumbreite und -höhe leben. In Kombination oder als Ergänzung ist die Untersparrendämmung aber unbedingt in Betracht zu ziehen.
- Die aufwendigste Methode ist auch die effektivste. Für Neubauten wird die Aufsparrendämmung daher meist direkt eingeplant. Im Nachhinein ist sie nämlich nur mit großem Aufwand umzusetzen. Denn das Material zum Dämmen wird hier zwischen Sparren und Eindeckung angebracht.
Bei nachträglicher Aufsparrendämmung heißt das also: Runter mit der Dacheindeckung. Den Aufwand muss jeder für sich mit den Vorteilen abwägen. Maximale Effektivität und eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, dafür allerdings höherer baulicher Aufwand und in der Folge auch mehr Kosten.

Dachdämmung auch mit Einblasverfahren möglich?
Wie bei der Fassadendämmung ist das Einblasverfahren auch fürs Dach gut geeignet. Hierfür wird typischerweise eine Verkleidung auf den Sparren befestigt. Dadurch entstehen einzelne Dämmkammern, in die Löcher für den Einblasschlauch gebohrt werden. Durch Luftdruck wird der Wärmedämmstoff zwischen die Sparren geblasen, verteilt sich gleichmäßig und erreicht die kleinsten Lücken. Voraussetzung ist, dass die Hohlräume geschlossen und trocken sind. Je nach Budget, benötigter Dämmleistung und Platz können Flocken, Fasern, Schaum, Perlite oder Granulate als Dämmstoffe eingeblasen werden. Das Verfahren ist vergleichsweise günstig und schnell umsetzbar – allerdings nicht immer geeignet, etwa bei offenem Dachstuhl oder fehlender luftdichter Schicht.
Materialien für die Dachdämmung: Was passt zu meinem Dach?
Das klassische Bild, das die meisten bei einer Dämmung im Kopf haben, sind wohl die typischen gelben Filzmatten. Diese bestehen aus Mineralwolle, meist Glas- oder Steinwolle. Preislich im mittleren Bereich überzeugt die Dämmung besonders durch einen guten Feuchtigkeitsschutz und dadurch, dass das Material nicht brennbar ist. Zudem ist Mineralwolle langlebig, schädlingsresistent und einfach zu verarbeiten – allerdings nicht recyclebar.
Ökologischer ist der Einsatz von organischem Dämmmaterial. Beispielsweise Holzfasern, die aus Holzresten hergestellt werden oder Zellulose aus recyceltem Zeitungspapier. Die umweltfreundlichen Materialien können entweder in Form von Flocken mit Hilfe der Einblasdämmung eingeblasen werden oder finden als Platten oder Matten Verwendung. Von Hanf über Kokosfasern bis hin zu Seegras gibt es eine breite Palette an organischen Dämmstoffen. Diese punkten durch gute Hitzeschutzwerte im Sommer, sind meist diffusionsoffen (atmungsaktiv) und klimaregulierend. Sie sind jedoch relativ teuer und haben geringere Brandschutzklassen.
Abseits von mineralischen und organischen Materialien zur Dachdämmung gibt es auch synthetische Stoffe. Meist sind diese besonders dicht, können deshalb in dünneren Schichten zum Einsatz kommen und dämmen sehr effektiv. Beispiele sind Polyurethan oder Polyisocyanurat (PIR). Sie erreichen mit geringer Dicke sehr niedrige U-Werte und eignen sich daher gut bei begrenztem Platzangebot, sind aber in der Herstellung energieintensiv, nicht nachhaltig und brennbar (wenn auch mit Flammschutzmitteln versehen).
Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil nach außen verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Für die Dachdämmung von Wohnhäusern ist laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der Regel ein maximaler U-Wert von 0,24 W/(m²K) vorgeschrieben. Das bedeutet, dass pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen maximal 0,24 Watt verloren gehen dürfen.
Dachdämmung bei schwacher Statik: Leichte Dämmstoffe für empfindliche Dachkonstruktionen
Gerade bei älteren Gebäuden stellt sich vor der Dämmung die Frage: Hält das Dach die zusätzliche Last überhaupt aus? Denn viele Dämmstoffe bringen einiges an Gewicht mit – besonders bei Aufsparrendämmungen oder schweren Materialien wie Holzfaserdämmplatten.
Bevor es losgeht, sollte daher ein Statiker prüfen, wie belastbar die Dachkonstruktion ist. Reicht die Tragfähigkeit nicht aus, kommen leichtere Dämmstoffe wie Zellulose, EPS oder PUR infrage. Alternativ muss die Dachkonstruktion gezielt verstärkt werden.
Wenn die Statik ohnehin knapp bemessen ist, kann eine Zwischensparrendämmung oder Einblasdämmung oft eine gute Lösung sein. Beide Methoden belasten das Dach in der Regel weniger als eine vollflächige Aufsparrendämmung.
Wie hoch sind die Kosten einer Dachdämmung?
Bei den Kosten einer Dachdämmung gibt es einige Stellschrauben. Die wichtigsten sind:
- Arbeitskosten
- Materialkosten
- Bauliche Maßnahmen
- Entsorgungskosten
- Förderungen
Wie hoch sind die Arbeitskosten bei einer Dachdämmung?
Das kommt darauf an, was die Handwerker machen sollen. Der Arbeitsaufwand der verschiedenen Dämmmethoden ist sehr unterschiedlich. Am günstigsten ist meist die Untersparrendämmung. Hierbei können Sie pro Quadratmeter mit ca. 30-80 € rechnen. Die Zwischensparrendämmung kann ein wenig teurer werden, unterscheidet sich preislich aber meist kaum. Ein Orientierungswert liegt zwischen 40 und 100 €. Wie weiter oben schon beschrieben, ist eine Aufsparrendämmung meist nicht ohne ergänzende Arbeitsschritte möglich. Die Kosten von 120-200 € pro Quadratmeter lohnen sich daher besonders, wenn eh eine Neueindeckung oder ein Dachausbau geplant ist.
Materialkosten für die Dachdämmung
Die Vielzahl an Dämmstoffen kann preislich nicht über einen Kamm geschoren werden, denn um den vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) angestrebten U-Wert von 0,24 W/(m²K) zu erreichen, bedarf es unterschiedlicher Materialdicken. Bei Zellulose beispielsweise rechnet man mit einer 16 cm Schicht. Glaswollmatten erreichen den U-Wert erst bei 24 cm und bei Holzwolle müsste die Dämmung schon 34 cm dick sein. Bei der Verwendung als Einblasdämmstoff variieren die Preise wieder.
Zur groben Orientierung hier einige bewährte und gut dämmende Materialien zur Dachdämmung im Vergleich:
|
Dämmmaterial mit einem U-Wert von 0,24 W/(m²K) |
Kosten in € pro m² |
|
Zellulose, Stroh, Holzfaser, Expandiertes Polystyrol (EPS) |
ca. 10–20 € |
|
Jute (15 cm), Schafwolle (16 cm), Polyurethan (PUR) (10 cm) |
ca. 20–30 € |
|
Perlit (20 cm) |
ca. 30–50 € |
|
Mineralschaum (20 cm) Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) (19 cm) |
ca. 50–100 € |
Beispielrechnung: Was kostet die Dachdämmung bei einem Einfamilienhaus?
Nehmen wir an, Sie möchten das Satteldach Ihres Einfamilienhauses nachträglich dämmen. Die Dachfläche beträgt 120 m² und Sie entscheiden sich für eine Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle.
- Fläche: 120 m²
- Dämmmaterial (Mineralwolle): ca. 20 €/m² →400 €
- Arbeitskosten: ca. 60 €/m² →200 €
- Entsorgung & Zusatzkosten (z. Dampfsperre, Folien): ca. 1.000 €
Gesamtkosten: ca. 10.600 €
Wenn Sie zusätzlich eine Untersparrendämmung kombinieren oder auf eine Aufsparrendämmung umsteigen, kann sich der Betrag schnell auf 15.000 € oder mehr erhöhen. Dafür sinken aber Ihre Heizkosten deutlich – im Schnitt um bis zu 20–30 %. Je nach Energiepreisen kann sich die Investition also innerhalb von 10 bis 15 Jahren amortisieren, zumal Förderungen und steuerliche Absetzbarkeit die Kosten weiter reduzieren können.
Komplett kostenlos | 100 % unverbindlich
Weniger Kosten dank Förderung zur Dachdämmung
Wer sich jetzt einen Überblick der Posten gemacht hat, ist von der Summe unterm Strich wahrscheinlich erst einmal ernüchtert. Aber auf den gesamten Kosten einer Dachdämmung bleiben Sie eventuell nicht allein sitzen, denn es gibt verschiedene staatliche Förderungen, über die Sie auch in einer Baufinanzierungsberatung informiert werden.
Die energetischen Anforderungen für Gebäude sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Das Hauptziel besteht in der Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden in Deutschland. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) können Hausbesitzer staatliche Unterstützung für energetische Einzelmaßnahmen wie die Dachdämmung erhalten.
Erste Anlaufstelle für Interessierte ist meist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wer sich allerdings vorerst nicht auf umfangreiche Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen einlassen möchte, sollte sich erst über einen Zuschuss der BAFA informieren. Sanierungsarbeiten am Dach, die mehr als 2.000 € kosten, kommen nämlich für das Förderprogramm in Frage. Hierbei fördert die BAFA Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, die zur Verbesserung der Energieeffizienzklasse des Hauses beitragen. Für eine Dachdämmung beträgt der Fördersatz 15 % der entsprechenden Ausgaben.
Weitere 5 % können eventuell mit dem iSFP-Bonus gespart werden. Eigenheimbesitzer, die sich von einem Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen und diesen innerhalb der nächsten 15 Jahre umsetzen, werden von der BAFA dafür belohnt. Und da auch die Arbeit des qualifizierten Energieberaters mit bis zu 80 % von der BAFA bezuschusst wird, kann sich das schnell lohnen.
Jetzt aber zur KfW: Hier kann über den Kredit 261 für Wohngebäude eine Darlehenssumme von bis zu 150.000 € beantragt werden. Um sich für diesen vergünstigten Kredit zu qualifizieren, reicht eine Dachdämmung allein aber nicht aus. Es muss schon eine Komplettsanierung zum Effizienzhaus umgesetzt werden.
Kombination von BAFA und KfW – geht das?
Eine gleichzeitige Förderung durch BAFA und KfW für dieselbe Maßnahme (z. B. Dachdämmung) ist nicht möglich. Sie müssen sich entscheiden: Entweder Zuschuss über die BAFA oder zinsgünstiger Kredit über die KfW.
Eine Kombination ist nur erlaubt, wenn die Maßnahmen sich nicht überschneiden, z. B.
- BAFA-Zuschuss für die Dachdämmung
- KfW-Kredit für eine neue Heizung
Wichtig: Wenn weitere Fördermittel dazukommen (z. B. von Bundesländern oder Kommunen), darf die Gesamtsumme maximal 60 % der förderfähigen Kosten ausmachen (bei KfW-Effizienzhaus 40 sogar bis zu 90 %).
Wer sich nicht für eine der Förderungen qualifiziert oder die Finanzierung lieber in die eigene Hand nimmt, sollte daran denken, das Dach Dämmen steuerlich geltend zu machen. Wenn die Arbeiten am Dach abgeschlossen sind, können über die folgenden drei Jahre verteilt bis zu 40.000 € abgesetzt werden. Das lohnt sich in jedem Fall.
Dachdämmung in Eigenleistung – was ist möglich?
Wer handwerklich geschickt ist, kann bei der Dachdämmung durchaus selbst mit anpacken – zumindest teilweise. Besonders bei der Untersparrendämmung oder der Zwischensparrendämmung lassen sich Vorarbeiten wie das Zuschneiden und Einsetzen der Dämmplatten auch in Eigenregie übernehmen. Wichtig ist dabei, exakt zu arbeiten und die Dämmmaterialien lückenlos zu verlegen, damit es nicht zu Wärmebrücken kommt.
Komplexer wird es bei der Aufsparrendämmung oder der Einblasdämmung. Hier sind Spezialwerkzeuge, statisches Know-how und vor allem Erfahrung gefragt. Diese Arbeiten sollten Sie besser Fachbetrieben überlassen, zumal Fehler teuer werden können. Auch die luftdichte Ausführung (z. B. mit Dampfsperren oder Dampfbremsen) ist anspruchsvoll und entscheidet über die Wirksamkeit der Dämmung.
Sie möchten sparen? Dann können Sie viel tun: Das Dachgeschoss vorbereiten, altes Dämmmaterial entfernen oder die Dampfsperre aufbringen. Aber die eigentliche Dämmung überlassen Sie dann doch dem Profi. Die Kombination aus Eigenleistung und professioneller Ausführung ist auch förderfähig – lassen Sie sich dazu am besten individuell beraten.