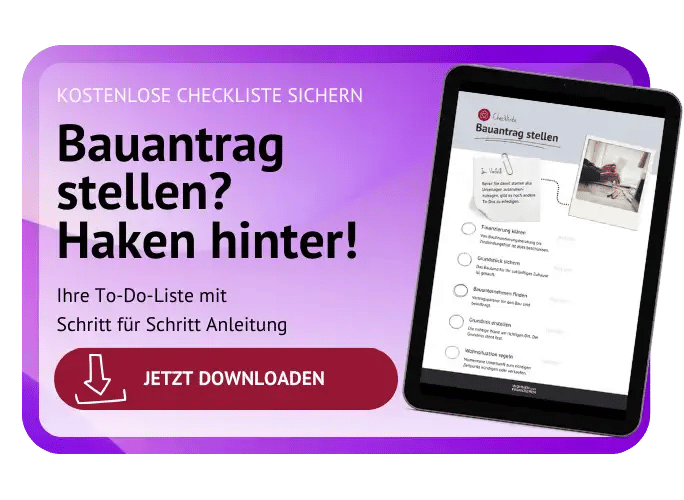Schöner wohnen, mehr Platz oder ein bisschen mehr Luxus: Viele Hausbesitzer träumen davon, ihr Eigenheim zu erweitern.
Mit einem Anbau gewinnen Sie ein Extra-Zimmer für die wachsende Familie, einen lichtdurchfluteten Wintergarten zum Entspannen oder eine großzügige Wohnküche. Und ganz nebenbei steigern Sie auch den Wert Ihrer Immobilie. Was Sie bei der Planung, den Kosten und der Finanzierung Ihres Anbaus beachten sollten, erfahren Sie hier.
Anbauen im Schnelldurchlauf
- Ein Hausanbau schafft mehr Wohnraum und steigert den Immobilienwert.
- Für den Anbau ist eine Baugenehmigung und oft auch die Zustimmung der Nachbarn erforderlich.
- Bautechnische Vorschriften wie Statik, Brandschutz und Energieeffizienz müssen beachtet werden.
- Im Schnitt liegen die Kosten für einen Anbau zwischen 1.300 € und 3.000 € pro qm.
- Der Anbau kann mithilfe einer Baufinanzierung plus Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) realisiert werden.
Kosten für Hausanbau schnell berechnen
Der nachfolgende Hausanbau-Rechner hilft dabei, eine ungefähre Kostenindikation zu erhalten. Geben Sie dazu nur ein paar wenige Informationen an.
Die Berechnung basiert auf Durchschnittswerten und kann regional variieren. Enthalten sind Grundkosten, Ausstattung, Dach, Fenster & Türen, Bodenbeläge sowie Genehmigungs-, Planungs- und Baunebenkosten.
Den Hausanbau planen in 3 Schritten
Schritt 1: Art des Anbaus bestimmen
Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Anbaumöglichkeiten – vom kleinen Nebenraum bis zur kompletten Miniwohnung im Haupthaus. Am Anfang steht also eine Bedarfsanalyse, um zu klären, was genau angebaut wird: Brauche ich ein oder zwei Zimmer für mehr Wohnraum? Plane ich ein barrierefreies Mehrgenerationenhaus? Soll es eine Einliegerwohnung werden, die ich später vermiete?
Schritt 2: Bauweise und Integration planen
Neben dem „Was“ ist auch das „Wie“ zu klären. Je nach Zweck und Platzbedarf planen Sie gemeinsam mit Ihrem Architekten, wie der Anbau in das bestehende Haus integriert wird. Die neuen Räume bzw. die neue Wohneinheit sollte effektiv genutzt werden können. Bei der Planung wird sich zeigen, ob z. B. ein kleinerer seitlicher oder rückwärtiger Anbau besser geeignet ist oder ob bereits ein größerer Erker für Ihr Bauvorhaben ausreicht.
Schritt 3: Genehmigungen und Vorschriften beachten
Bevor der Bagger anrollt, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sein. Dazu gehört in den meisten Fällen eine Baugenehmigung der zuständigen Baubehörde – ohne sie riskieren Sie Bußgelder von bis zu 50.000 € oder im schlimmsten Fall den Rückbau. Gleichzeitig müssen Bauvorschriften wie Statik, Brandschutz, Abstandsflächen und Energieeffizienz eingehalten werden. Ein erfahrener Architekt oder Bauingenieur hilft Ihnen, all das zu berücksichtigen und den Bauantrag vollständig einzureichen.
Übrigens: Auch wenn es sich bei Ihrem geplanten Anbau um keine Grenzbebauung handelt, so wäre Nachbars Unterschrift auf dem Bauantrag für die Erweiterung trotzdem wünschenswert. Dadurch verzichtet er auf sein Widerspruchsrecht und kann später nicht klagen. Informieren Sie als Bauherr Ihre Nachbarn rechtzeitig über den Beginn und den Ablauf der Arbeiten, damit Ihr beider Hausfrieden nicht unnötig gestört wird und Sie sich auch künftig noch gut verstehen.
Brauche ich für jeden Anbau eine Baugenehmigung?
Generell ja. Für fast alle baulichen Maßnahmen zur Erweiterung der Wohnfläche ist eine Genehmigung Pflicht. Die Vorschriften dazu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt, daher können die Regelungen regional variieren.
Kleinere Anbauten zu Nichtwohnzwecken (z. B. Gartenhäuser, Carports, Geräteschuppen) können unter Umständen genehmigungsfrei sein, häufig bis zu einer Größe von etwa 30–40 m² pro Bundesland. Stellen Sie am besten eine Bauvoranfrage, um auf der sicheren Seite zu sein.
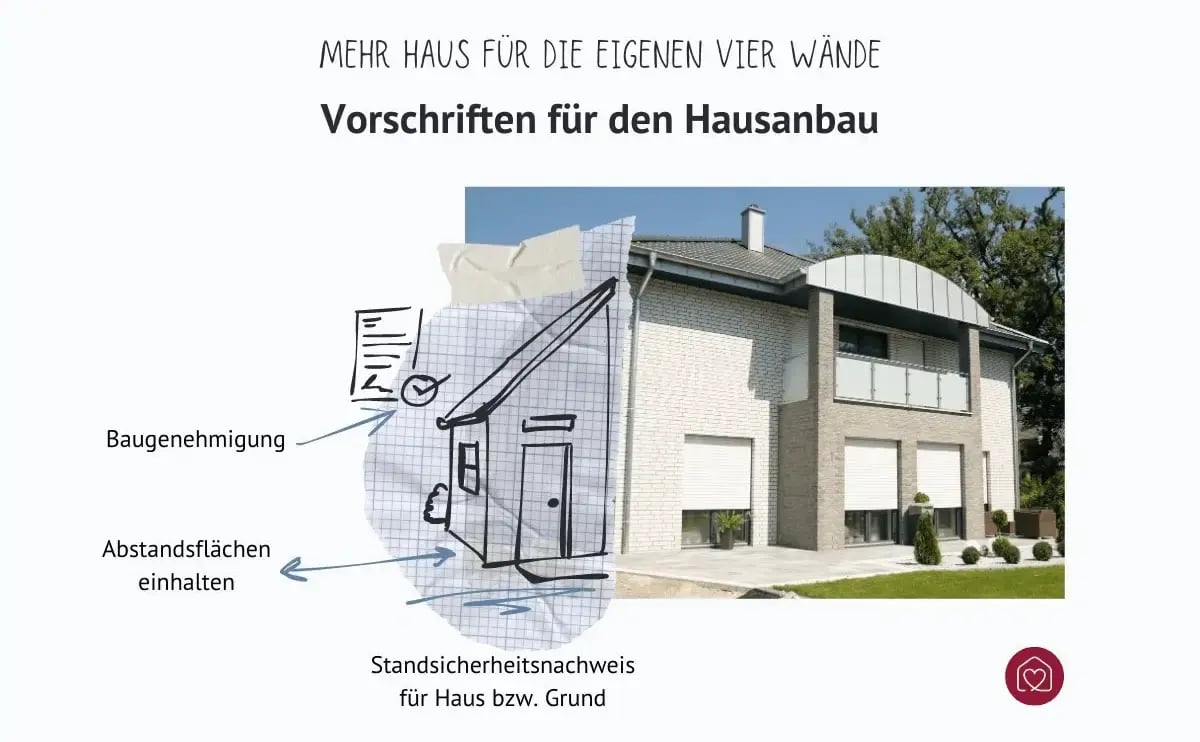
Bautechnische Vorschriften beim Anbau an ein bestehendes Haus
Nachdem Ihr Architekt die Entwürfe angefertigt hat, spricht er diese mit dem Bauleiter ab und zeichnet die finale Bauvorlage. Die Bauarbeiten können also beginnen.
Damit Ihr Anbau sicher, funktional und schön wird, müssen bei den Arbeiten bautechnische Aspekte beachtet werden. Neben der Einhaltung der bereits erwähnten Bauvorschriften (Brandschutzvorschriften, energetische Vorgaben, Abstandsregelungen etc.) sind dies folgende:
- Tragfähigkeit und Statik: Ein Statiker oder Bauingenieur bewertet die Tragfähigkeit Ihres Hauses und des Baugrunds. Das Bestandsgebäude muss das zusätzliche Gewicht des Anbaus tragen können.
- Anschlüsse: Der Anbau muss sicher und dicht an das bestehende Gebäude angeschlossen werden. Dies betrifft sowohl konstruktive Aspekte (z. B. die Durchdringung von Wänden für Türen oder Fenster) als auch technische Aspekte (z. B. Elektroinstallationen, Heizung und Sanitär).
- Materialwahl für Fassade, Dach und Innenräume: Hierbei ist wichtig, dass die gewählten Materialien zu den Anforderungen des neuen Anbaus passen. Natürlich berücksichtigt man bei der Wahl auch das gewünschte Aussehen, die Kosten, die Langlebigkeit und die Energieeffizienz.
Video zum Thema Anbau ans bestehende Haus
Wie groß darf der Anbau maximal sein?
Eine pauschale Obergrenze gibt es nicht. Die maximal zulässige Größe eines Anbaus hängt vor allem vom Bebauungsplan, der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der jeweiligen Landesbauordnung ab. In der Regel bestimmt die Differenz zwischen der maximal erlaubten Bebauung und dem Ist-Zustand die Größe des möglichen Anbaus. Mögliche Restriktionen können durch Baulasten, Abstandsflächen, Etagenzahl und gegebenenfalls Denkmalschutz entstehen.
Wie lange dauert ein Anbau am Haus?
Oft unterschätzt: Die längste Zeit frisst nicht der eigentliche Bau, sondern die Planungs- und Genehmigungsphase.

Anbau: Kosten und Finanzierung für mehr Wohnkomfort
Kommen wir zum finanziellen Aspekt. Wie setzen sich die Kosten für einen Hausbau zusammen? Neben den Materialkosten sowie dem Bauleiter- und Architektenhonorar müssen folgende Arbeiten bezahlt werden:
- Erdarbeiten und Fundament
- Rohbau, Maurerarbeiten und Dachkonstruktion
- Fassade, Fenster und Türen
- Heizung und Wärmedämmung
- Elektrik und Wasseranschlüsse
- Innenausbau
Natürlich hängen die Kosten für Ihren zukünftigen Anbau maßgeblich von seiner Art und der Ausstattung ab, von den gewählten Materialien, der Größe und dem Arbeitsaufwand. Aber zur Orientierung können Sie von folgenden Zahlen ausgehen: Im Schnitt kostet ein Anbau pro Quadratmeter von 1.500 € bis 3.000 €.
Anbauen ist also eine recht preisintensive Angelegenheit. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Baupreise stark gestiegen. Allein im Jahr 2025 zogen die Baupreise für Wohngebäude um 3,2 % gegenüber dem Vorjahr an. Dabei stiegen die Preise für Ausbauarbeiten mit +3,7 % etwas stärker als die Kosten für Rohbauarbeiten mit +2,5 %.
Kostenbeispiel 1: Preise für einen 30 m²-Anbau
| Kostenpunkt | Preis |
| Bauantrag, statische Berechnung & Wärmeschutznachweis | 6.000 € |
| Durchbruch in das Bestandsgebäude | 2.000 € |
| Boden und Fundament | 9.000 € |
| Außenwände und Dachkonstruktion | 20.000 € |
| Fassade Außenputz | 4.000 € |
| Fenster und Tür mit Rollladen | 7.000 € |
| Eingangstür | 3.000 € |
| Heizung | 2.000 € |
| Elektroinstallationen | 1.000 € |
| Estrich und Bodenbelag | 4.500 € |
| Malerarbeiten | 500 € |
| Gesamtkosten | 59.000 € |
Kostenbeispiel 2: Anbau eines 30 m² Wintergartens
| Kostenpunkt | Preis |
| Baugenehmigung, statische Berechnung | 3.000 € |
| Bodenaufbereitung, Entsorgung von Abfällen | 6.000 € |
| Materialkosten (Glas, Aluminiumrahmen, Dämmstoffe) | 30.000 € |
| Arbeitskosten (Maurer, Fensterbauer, Installateure) | 18.000 € |
| Heizung, Lüftung | 9.000 € |
| Gesamtkosten | 66.000 € |
Was kostet ein Anbau von 50 qm?
Gehen wir von der oberen Schätzung aus, so kann ein Anbau von 50 m² zwischen 75.000 € und 150.000 € kosten. Kleinere Anbauten werden dementsprechend etwas preiswerter z. B. kostet ein Anbau von 30 m² zwischen 45.000 € und 90.000 € – wie oben aufgeschlüsselt.
Was davon lässt sich steuerlich absetzen?
- Für selbst genutzte Eigenheime können die reinen Arbeitskosten von Handwerkerleistungen steuerlich geltend gemacht werden (maximal 1.200 € pro Jahr, nur mit Überweisung und sauber getrennter Rechnung).
- Materialkosten sind nicht absetzbar.
- Wer eine öffentliche Förderung (z. KfW-Zuschuss) für dieselbe Maßnahme erhält, kann diese nicht gleichzeitig steuerlich absetzen.
- Bei Vermietung gilt: Die Kosten für den Anbau werden als Herstellungskosten angesetzt und über viele Jahre abgeschrieben.
Versicherungen beim Hausanbau: Was wirklich wichtig ist
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Pflicht für Bauherren. Schützt vor Schadenersatzforderungen, wenn Dritte auf der Baustelle zu Schaden kommen.
Bauleistungsversicherung
Sichert das Bauvorhaben gegen unvorhergesehene Schäden ab (z. B. Sturm, Vandalismus, Materialfehler).
Feuer-Rohbauversicherung
Greift bei Brand- oder Blitzschäden während der Bauphase. Häufig kostenlos, wenn anschließend eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen wird.
Wohngebäudeversicherung anpassen
Nach Fertigstellung unbedingt den neuen Anbau in die Police aufnehmen, sonst ist er nicht geschützt.
Tipp: Auch an Helfer-Unfallversicherung oder Rechtsschutz denken, falls Freunde mit anpacken oder es zu Streitigkeiten mit Handwerkern kommt.
Wie Sie den Anbau finanzieren können
Das Projekt Hausanbau können Sie über eine Baufinanzierung verwirklichen. Dies ist die zinsgünstigste aller Varianten. Die Bank prüft, zu welchem Teil Ihre Immobilie bereits abbezahlt ist, sieht sich den aktuellen Wert des Objektes an und stellt diesem das verbleinende Darlehen gegenüber. Je mehr Sie bereits zurückgezahlt haben, desto besser.
Eine andere Variante ist der zweckgebundene Kredit. Dabei handelt es sich um einen Wohnkredit, mit dem Sanierungen und Anbauten in Höhe von 5.000 € bis 50.000 € finanziert werden können. Zwar sind die Zinsen eines zweckgebundenen Kredites etwas höher als die einer Baufinanzierung, dafür ist dieser aber unbürokratischer und schneller abbezahlt. Auch eine eventuelle Belastung Ihrer Immobilie spielt dabei keine Rolle.
Die dritte Option ist ein freier Ratenkredit ohne Zweckbindung. Dieser kann schnell und unkompliziert beantragt werden, aber dafür kommen höhere Zinsen auf Sie zu.
Wenn Sie Ihren Anbau nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) umsetzen, dann haben Sie die Möglichkeit, von Förderprogrammen der KfW zu profitieren. Diese greifen übrigens auch bei barrierefreien Anbauten. Sollten Sie Ihr Bestandsgebäude inklusive des Anbaus energetisch sanieren können Sie die Förderungen der BEG in Anspruch nehmen.
Wie Sie sehen, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können. Wir empfehlen an dieser Stelle immer, den Rat eines Fachexperten einzuholen. Nehmen Sie gern eine Baufinanzierungsberatung in Anspruch – diese kostet nichts und wird Ihnen Klarheit über Finanzierung und Förderung verschaffen.
Komplett kostenlos | 100 % unverbindlich
Nachhaltigkeit beim Hausanbau
Mit der Realisierung des Anbaus bietet sich eine perfekte Gelegenheit, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen und den ökologischen Fußabdruck Ihres Hauses zu reduzieren. Nachhaltigkeit und Green Living spielen eine immer wichtigere Rolle in der Bauindustrie – und eine Schlüsselkomponente davon ist die Energieeffizienz Ihres Hauses.
Bei Ihrem Anbau ans bestehende Haus haben Sie die Möglichkeit, erneuerbare Energien einzusetzen. Integrieren Sie z. B. eine Photovoltaikanlage in das Dach des Anbaus, um Sonnenlicht in Elektrizität umzuwandeln, oder installieren Sie eine umweltfreundliche Wärmepumpe oder Fußbodenheizung, um das Haus mit erneuerbarer Energie zu heizen.
In Bezug auf umweltfreundliche Baumaterialien bieten sich zahlreiche ressourcenschonende und recyclingfähige Optionen an. Entscheiden Sie sich z. B. für lokal produzierte Materialien, um den Transport und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ebenso kann der Einsatz von recyceltem Beton oder ökologischen Baustoffen wie Lehm und Stroh eine nachhaltige Alternative sein.
Sorgen Sie für eine gute Gebäudedämmung in Ihrem Anbau. Damit reduzieren Sie wiederum den Energieverbrauch. Hochwertige Dämmmaterialien sorgen dafür, dass Wärme im Winter im Gebäude bleibt und im Sommer draußen. Investieren Sie in moderne Dämmstoffe, wie z. B. Recycling-Zellulose. Der Einbau moderner Fenster mit Doppel- oder Dreifachverglasung verringert ebenfalls den Wärmeverlust im Winter und Sie müssen weniger heizen.
All diese Maßnahmen reduzieren nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern führen langfristig auch zu niedrigeren Betriebskosten. Zudem steigert eine nachhaltige Bauweise auch den Wert und die Attraktivität des Hauses.
Hausanbau-Ideen: Welche architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?
Sicherlich sollte bei der Planung Ihres Anbaus die Architektur Ihres bestehenden Hauses berücksichtigt werden. Aber wer sagt, dass der neue Bereich sich unbedingt perfekt in das Haus einfügen muss und seinen Charakter ergänzen sollte? Das ist zwar eine gängige Lösung, aber es geht auch anders.

Spannende Kontraste und unerwartete Vorgehensweisen sorgen für Wiedererkennbarkeit und Authentizität. So kann ein moderner Anbau mit Dachterrasse ein älteres Backsteinhaus wunderbar ergänzen. Ein Holzanbau an ein Massivhaus schafft eine auffallende Gegensätzlichkeit zwischen traditioneller und moderner Architektur. Ein schlichter Anbau mit Flachdach an ein Reihenhaus ist theoretisch genauso möglich, wie ein schicker Anbau mit Einliegerwohnung bei einem Einfamilienhaus.